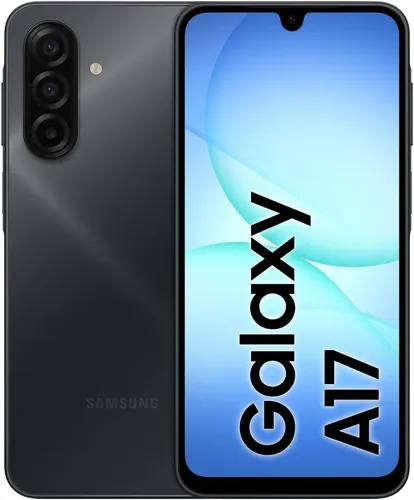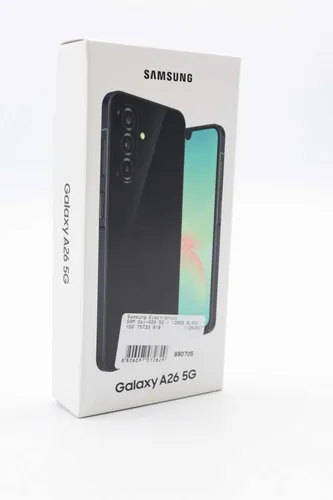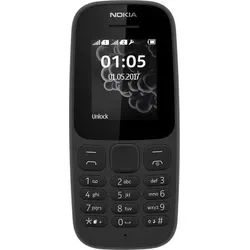Das Wichtigste auf einen Blick:
- es gibt verschiedene, unterschiedlich gute Standards
- als Schnellladen gelten offiziell 10 W und mehr
- viele Geräte schaffen aber schon 18 W und mehr
- Ladegerät und Ladetechnik müssen kompatibel sein
 Das Mi 11T Pro erreicht 120 W Ladestärke durch das gleichzeitige Laden zweier getrennter Akkuzellen. (Bildquelle: mi.com)
Das Mi 11T Pro erreicht 120 W Ladestärke durch das gleichzeitige Laden zweier getrennter Akkuzellen. (Bildquelle: mi.com)
Der Akku ist alle und Sie müssen schnell los? Früher war die Powerbank dafür die einzige gute Lösung, aber heute können schon wenige Minuten am Kabel für stundenlange Ausdauer sorgen – dank Schnellladefunktion und passendem Netzteil! Doch Schnellladen ist ein weit gefasster Begriff und es gibt große Unterschiede zwischen den Ladetechniken.
Wie blicken Tester auf die Ladegeschwindigkeit?
Nichts verärgert Smartphone-Nutzer:innen mehr, als wenn das Gerät schon vor Ablauf eines Arbeitstages wieder an die Steckdose muss. Denn ein Ladevorgang kostet Zeit, oftmals vergehen Stunden, bevor man das Handy wieder verwenden kann. Da aber die Größe des Akkus nur in Grenzen erhöht werden kann, richten sich die Augen der Hersteller – und damit auch der Testerinnen und Tester – zunehmend auf effektivere Ladetechniken. „Schnellladen“ wird auf dem Papier inzwischen von den meisten Smartphones unterstützt, doch zeigen gerade Tests immer wieder, dass Schnellladen eben nicht Schnellladen ist. Es gibt verschiedene Standards, die auch noch in unterschiedlichen Leistungsstufen implementiert werden.Daher lassen sich Tester:innen von solch schönen Worten gar nicht erst blenden, sondern blicken gleich auf die unmittelbar erbrachten Ladezeiten. Die hängen natürlich einerseits von der verwendeten Ladetechnik, andererseits aber auch der Größe des jeweiligen Akkus ab. Bei einem Modell mit 8.000 mAh Nennladung kann auch ein Ladevorgang von mehr als einer Stunde noch als fixes Schnellladen gelten, wohingegen bei einem Akku mit 4.000 mAh eher eine halbe Stunde erwartet wird. Dabei wird auch unterschieden in eine erste und eine zweite Hälfte des Ladevorganges. Denn Letztere dauert aus technischen Gründen stets länger, maßgeblich für die Praxis ist vor allem die Dauer des Ladevorgangs für die ersten 50 Prozent Ladung – eben das akute Schnellladen.
Die Hersteller im Vergleich: Lademeister Xiaomi, Apple nicht mal in der ersten Liga
In der Smartphone-Saison 2021/2022 wurden neue Rekorde bei der Ladegeschwindigkeit aufgestellt. Vor allem die chinesischen Hersteller sind in dieser Disziplin stark. Unangefochtener Meister ist Xiaomi, die mit ihrer 120-W-Ladefunktion die Konkurrenz deutlich überholen. Premium-Smartphone-Schmiede Apple ist hier überraschenderweise ein Zweitligist und nicht unter den Top 18 zu finden.
Was gilt als „echtes“ Schnellladen?
 USB Power Delivery nutzt ein eigenes Logo zur Kennzeichnung entsprechender "Fast Charger". (Bildquelle: usb.org)
USB Power Delivery nutzt ein eigenes Logo zur Kennzeichnung entsprechender "Fast Charger". (Bildquelle: usb.org)
Grundsätzlich gilt alles als Schnellladen, was zügiger arbeitet als die klassische Ladetechnik mit 5 W, die sich zusammensetzt aus einer Nennspannung von 5 V und 1 A Ladestrom. Da bei Smartphones in der Regel immer mit 5 V gearbeitet wird, sind primär höhere Ladeströme das Mittel der Wahl. Fast alle modernen Geräte werden heute bereits mit 2 A und somit 10 W geladen, wenn sie ihr eigenes Ladegerät verwenden. Obwohl es formell als Schnellladen gilt, wird dies doch von den meisten Nutzern bereits als normal oder gar langsam empfunden. Der Ladestandard sollte also deutlich mehr leisten können.
Die Hersteller setzen auf unterschiedliche Ladestandards, aber alle aktuellen Smartphones sind prinzipiell mit einem USB-Netzteil aufladbar. Anschlüsse und Netzteile mit Schnellladefunktion sind oftmals an einem Blitz-Symbol zu erkennen.
Welche Smartphones bieten die höchste Ladegeschwindigkeit?
Die Hersteller setzen auf ganz unterschiedliche Ladetechniken und auch -geschwindigkeiten. Während die Platzhirsche Apple, Google und Samsung eher auf Nummer sicher gehen und die Ladestärken unter 50 W belassen, experimentieren Hersteller wie Xiaomi mit geradezu wahnwitzig schnellen Ladestärken von inzwischen sogar über 100 W.Xiaomis Mi 11T Pro gehört zu den ersten Geräten mit 120 W Ladestärke und hat sogar ein passendes Netzteil dabei. Apple und Co. verzichten derweil darauf, überhaupt ein Netzteil mit in den Karton zu legen, was aus Nachhaltigkeits-Gründen aber durchaus nachvollziehbar ist.
Ist Schnellladen für das Gerät schädlich?
Wo viel Strom fließt, da steht auch die Hardware unter Last. Trotzdem ist das schnelle Aufladen für das Smartphone bzw. den Akku keine direkte Gefahr. Moderne Geräte gehen beim Aufladen smart vor und drosseln so zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit kurz vor 100 % Ladezustand, damit es nicht zu einer Überlastung kommt. Beim Schnellladen wird aber auch mehr Hitze erzeugt, als beim Aufladen in langsamem Tempo. Das Smartphone sollte also über ein gutes Kühlsystem verfügen und bei der Erreichung bestimmter Temperatur-Schwellwerte abbremsen, um die Lebensdauer der Hardware nicht zu verringern. In Tests wird oftmals geprüft, wie warm Smartphones beim Aufladen werden.Gibt es kabelloses Schnellladen?
Ja, gibt es. Hier ist die Kunst ganz einfach, die über Quick Charge oder USB-C angelieferte Energie mittels der Spulen möglichst verlustfrei ans Smartphone zu übertragen. Das bedingt natürlich wiederum, dass das Handy selbst eine kabellose Energieumwandlung beherrscht, die dann eben auch 18 oder gar 36 W korrekt in den Akku einspeist. Da bei dieser Induktionsladung aber noch viel größere thermische Verluste auftreten, ist das nicht ganz einfach. Letzten Endes sind die meisten kabellosen Ladegeräte mit nur 7,5 W recht langsam unterwegs. Nur wenige gehen bis auf 15 W hoch, und die sind aufgrund der aufwendigeren Ladetechnik eben auch spürbar teurer. Und natürlich muss auch das Smartphone diese Technik unterstützen, was aufgrund der stärkeren Entkopplung zwischen den Herstellern der Ladepads und der Smartphones selbst viel seltener ist als man es sich wünschen würde.Die besten Smartphones mit Schnellladen und kabellosem Laden
| Unser Fazit | Stärken | Schwächen | Bewertung | Angebote | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ab 1082,00 €  Sehr gut 1,0 |
Das neue Nonplusultra für Gamer Weiterlesen |
Weiterlesen |
Weiterlesen |
12 Meinungen 1 Test |
|
|
ab 730,25 €  Sehr gut 1,3 |
Individuell gestaltbares High-End-Smartphone mit beeindruckender Kamera und schneller Performance Weiterlesen |
Weiterlesen |
Weiterlesen |
313 Meinungen 5 Tests |
|
|
ab 1018,27 €  Sehr gut 1,3 |
Highend in alter Huawei-Manier Weiterlesen |
Weiterlesen |
Weiterlesen |
48 Meinungen 13 Tests |